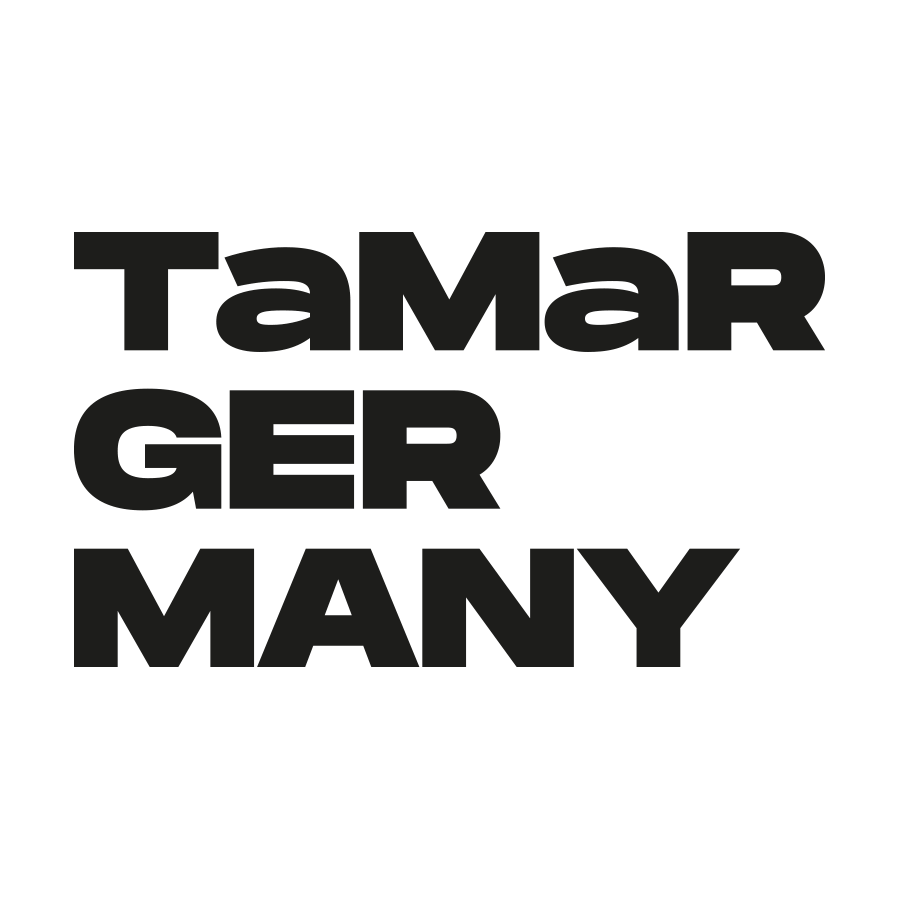Über Selbstverständlichkeiten
Von Katja Sigutina
Vor einigen Tagen trafen wir uns für ein TaMaR Seminar in einem Bildungshaus in Brandenburg, um drei Tage lang über jüdische Selbstermächtigung und Widerständigkeit zu diskutieren.
Nachdem ich 2018 Max Czollek‘s Buch „Desintegriert euch!“ gelesen hatte, wollte ich den Publizisten für einen TaMaR Workshop einladen. Der Plan entwickelte sich dahin, dass wir gemeinsam mit einem Team ein ganzes Seminar dazu planten, welches Corona-bedingt verschoben wurde. Dass wir den Termin bereits ein Jahr später nachholen würden, war, gemessen an der Unplanbarkeit, die das Pandemiejahr mit sich brachte, nicht immer selbstverständlich.
Für mich persönlich sollte dieses Seminar in Brandenburg das vorerst letzte sein, welches ich für TaMaR organisierte. Aus diesem Grund verabschiedete ich mich bei der letzten Mitgliederversammlung auch aus dem Vorstand des Vereins. 15 Jahre ehrenamtliche Arbeit in der jüdischen Community verlangen nach einer Verschnaufpause.
Die Tatsache, dass ich überhaupt in einem jüdischen Kontext aufgewachsen bin, welches auch den Rahmen für mein Engagement bildete, ist in diesem Land nach wie vor die Ausnahme. Für die meisten Jüd*innen in Deutschland ist ihr Jüdischsein oft entweder eng mit einer Gefahr von außen verknüpft, oder mit dem Gefühl der Isolation. Ersteres, weil ihnen von ihren Lieben nahegebracht wird, dass man damit vorsichtig, und öffentlich lieber gar nicht umgehen sollte, aus Angst bzw. der Erfahrung von Anfeindung und Hass. Zweitens, da man neben der Familie keine anderen jüdischen Menschen kennt und daher das Gefühl der Einsamkeit und Verlorenheit den Platz einnimmt.
Nun verlief mein meist offen kommuniziertes Jüdischsein bisher zufällig angst- und gewaltfrei. Zufällig, weil ich bisher das Glück hatte, einfach nicht zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Wie sehr zufällig das ist, hat nicht zuletzt der rechtsterroristische Anschlag auf die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag bewiesen. An diesem Feiertag, Yom Kippur, gehen auch viele der säkularsten Jüd*innen in die Synagoge. In einem Hollywoodfilm habe ich sogar einmal gehört, dass in Synagogen in den USA verschiebbare Wände installiert sind, um die Räume für die Hohen Feiertage zu vergrößern, wenn alle zum Versöhnungstag zusammenkommen. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
Dieser jüdische Raum, in dem ich in Deutschland aufwuchs, war für mich eine lange Zeit sicher und selbstverständlich. Selbstverständlicherweise war ich in einer egalitären jüdischen Gemeinde beheimatet, selbstverständlicherweise fuhr ich jeden Sommer und Winter auf jüdische Ferienfreizeiten, selbstverständlicherweise fand ich dort Freund*innen, die meine Lebensrealität teilten, obwohl sie in München, Bad Segeberg, Berlin oder Mönchengladbach aufwuchsen. Und selbstverständlicherweise erzählte ich davon meinen nichtjüdischen Freund*innen in der Schule oder im Sportverein. Dass ich damit auch einen selbstverständlichen Aufklärungsauftrag mit mir herum trug, war Teil davon. Jedem und jeder, der*die danach fragte, erklärte ich geduldig, was Shabbat ist, ob ich Schweinefleisch aß und wieso nicht, ob ich streng religiös lebte und wieso nicht und ob ich Palästinenser*innen hasste und wieso nicht. Stellvertreterin für den Nahostkonflikt zu sein und entweder Aufklärerin oder Moderatorin für alle, die Redebedarf zum Thema hatten, immer inklusive. All das tat ich selbstverständlicherweise seit der Schulzeit. Es galt, solange ich keine Gewalt erfuhr, war alles im grünen Bereich.
Da ich selbstverständliches jüdisches Aufwachsen und Leben weitergeben wollte, engagierte ich mich schon früh: Gründung des jüdischen Jugendzentrums, Ausbildung zur Madricha, Planung und Durchführung der gleichen Kinder- und Jugendfreizeiten, auf die ich selbst gefahren war. Mit dem eigenen Wechsel von Schule zu Universität folgte auch der fließende Übergang von der Jugend- zur Erwachsenenbildung. Seit nun 10 Jahren bin ich also bei TaMaR Germany aktiv, was vor kurzem noch Jung und Jüdisch Deutschland hieß. In meiner Zeit als Vorstandsvorsitzende lag es mir am Herzen, alles, was ich für kommende Generationen wichtig fand, anzustoßen und zu verändern, wie es auch andere vor mir getan hatten, bevor ich mich aus dieser Arbeit zurückziehen wollte.
Dazu gehörte dann auch das Seminar, welches wir vor einigen Tagen in Brandenburg durchführten. Nach anderthalb Jahren befand ich mich zum ersten Mal wieder in einem jungen jüdischen Raum, in dem wir gemeinsam lernen und uns austauschen wollten. Zum ersten Mal empfand ich es nicht als selbstverständlich, mich mit anderen jungen, jüdischen, engagierten und neugierigen Menschen bei einem Seminar zu treffen. Denn diese anderthalb Jahre dazwischen waren nicht bloß von Corona-bedingter sozialer Isolation geprägt gewesen. Es war auch eine Zeit voller Breaking News über rechtsterroristische Netzwerke (innerhalb Behörden und Institutionen) und brutaler Hasstaten, bei denen sich die Pausen zwischen den Schlagzeilen kontinuierlich verkürzten. Auch waren es anderthalb Jahre, in denen die Informationsverbreitung an Geschwindigkeit zugenommen und soziale Medien die Hauptbühne für sowohl aktivistische als auch scheinaktivistische Handlungen wurden. Für mich persönlich waren es auch anderthalb Jahre, die geprägt waren von einem intensiven Lernprozess in vielen bereits genannten und noch mehr ungenannten Themenkomplexen. Ein Prozess allerdings, den ich größtenteils alleine durchlaufen war.
Umso stärker und nachhallender war der Eindruck, der auf mich einwirkte, als ich mich vor einigen Tagen in Brandenburg inmitten einer Gruppe von intelligenten, starken, kritischen und selbstbewussten Menschen wiederfand. Dadurch, dass ich diesen Raum in der Vergangenheit immer als selbstverständlich wahrgenommen hatte und durch die Pandemie das Zusammenkommen auch in diesem geschützten Raum nicht möglich war, sensibilisierte dies erst meine Wahrnehmung für dessen Besonderheit.
Diese Räume sind wichtig, da dort das Gefühl des nicht-Alleinseins generiert wird. In denen es Verständnis gibt ohne Erklärung und eine Gleichzeitigkeit von Dissens und Respekt. Wo Widersprüchlichkeit nicht mit Unbehagen gekoppelt ist. Wo Traumata sensibel begegnet wird. Und wo das Gefühl der Ohnmacht geteilt wird, ohne daraus Panik entstehen zu lassen. Es kann sich ein Wir-Gefühl entwickeln. Keines, welches von außen aufoktroyiert wird, weil nun mal gerade ein Festjahr begangen, eine Weltverschwörung imaginiert, Stellvertreter*innen für einen 70-jährigen Konflikt gesucht oder einfach nur die altbekannten „Anderen“ als Kontrastmittel zum selbstverständlichen „Wir“ gebraucht werden. Sondern ein eigenes.
Die Wünsche, die ich für die gemeinsame Zeit in Brandenburg und darüber hinaus hatte, die Ziele, die ich für mein letztes organisiertes Seminar hatte, sind allesamt aufgegangen. Es wurde Mut gemacht, empowert und Impulse gesetzt, wie jede*r individuell und wir als Gruppe Strategien erarbeiten können, um uns zu ermächtigen und hoffentlich mit der Zeit all die konstruierten Bilder, die wir über Jahrzehnte in diesem Land aufgezwungen bekommen haben und die teils zu identitätsstiftenden Merkmalen für uns geworden sind, abzubauen und uns dieser zu entledigen. Denn vieles, womit wir hier selbstverständlicherweise aufgewachsen sind, ist schlicht und ergreifend nicht gut.
An alle, die diesen Text lesen und nicht zu den 0,27% in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden gehören, ich möchte mit einem Appell an euch enden:
Wenn ihr solidarisch mit unseren 0,27% sein wollt, dann müsst ihr jetzt aktiv werden.
Ich erwarte, dass ihr euch selbstständig bildet und informiert. Vor allem, wenn ihr auch nur an einer einzigen Diskussion zum Nahostkonflikt beteiligt wart oder bei einer der vielfältigen lustigen oder weniger lustigen Veranstaltung zum diesjährigen Festjahr teilnehmt. Ich erwarte von euch ein kritisches Hinterfragen, wenn es um diffamierende Darstellungen von Jüd*innen geht. Ich erwarte von euch, bestimmt und lautstark dagegen vorzugehen. Ich erwarte von euch ein selbstständiges Entlernen von lang tradierten antisemitischen Vorurteilen und Weltbildern, die in diesem Deutschland nun mal Tradition und Kontinuität haben. Wenn ihr dies nicht selbst in die Hand nehmt, es nicht selbst für wichtig erachtet, dann werden wir, die 0,27%, es nicht für euch erledigen.
Diese Rolle werden wir nicht weiter übernehmen. Diese Ablenkung werden wir nicht weiter dulden. Die 0,27% müssen sich darauf konzentrieren, die eigenen sicheren Räume auf- und auszubauen, anstatt die immer gleichen Apelle und Erklärungen an den Rest der Gesellschaft zu richten. Entweder ihr seid vertrauensvolle und verlässliche Allies oder wir brauchen euch nicht. Nicht an eurem 27. Januar oder 9. November. Und an keinem anderen Tag. Das Einzige, was ich dann noch von euch erwarte ist: Lasst uns möglichst offen damit umgehen.